Die Preise für Videokameras sind heute so niedrig,
dass die Versuchung unwiderstehlich ist, ein solches Wunderding mit auf den
Törn zu nehmen. Aber Achtung: Von der Werbung wird mit Slogans wie "semiprofessionell", "für den ernsthaften Amateur"
etc suggeriert,
dass man mit einer modernen Videokamera nur "draufhalten" muss, und
schon ist ein Fernsehbeitrag im Kasten.
Das ist falsch. Man muss schon einiges beachten,
um überhaupt zu einem Film zu kommen, der für andere auch nur "ansehenswert"
ist. Ein wirklich professionelles Ergebnis erreicht der Amateur praktisch nie.
Vor allem nicht auf einer Yacht. Andererseits ist das bewegte Bild ein vielfach
wirkungsvollerer Erinnerungswecker als ein Foto-Apparat, selbst wenn dieser
auch digital arbeitet - quasi heute der Standard (siehe auch Digitalfotografie an Bord).
Darüber hinaus haben die meisten Videokameras auch eine Foto-Funktion, so dass
sie auch zum Fotografieren oder zum Dokumentieren eingesetzt werden können.
Nachdem das "Film"-Material ja nichts kostet, ist es allemal besser,
irgendwelche Bilder zu haben als gar keine. Außerdem schau ich mir (eigene!)
verwackelte Filmszenen immer noch lieber an, als ein langweiliges Logbuch zu
lesen, das aus mehr oder weniger nichts sagenden Zahlen und Buchstaben -
"Ge, F 25 SW" oder so - besteht.
Aber die Tatsache lässt sich nicht wegdiskutieren:
Man kann beim Videofilmen eine Menge falsch machen, erst recht
auf einer Yacht. Fehler, die so leicht zu vermeiden
sind, wenn man sie sich erst bewusst macht. Das geht schon an beim Kauf einer
Kamera:
Welche Kamera?
Das Wichtigste vorweg: Ein unbearbeiteter Film
ist immer(!) eine Zumutung für den Zuseher. Deshalb muss bereits bei der
Anschaffung der Kamera an die nachträgliche Filmbearbeitung gedacht werden.
Daraus folgt, dass nur noch eine Kamera gekauft werden soll, die über ein
Videoformat verfügt, das eine Nachbearbeitung ermöglicht, ohne dass bei den unvermeidbaren
Kopiervorgängen die Filmqualität verschlechtert wird. Und das bietet im Moment nur das DV- oder das
Mini-DV-Format. Erst dieses Format hat im
Amateursektor ermöglicht, dass Kopien eins zu eins hergestellt werden können -
unbedingte Voraussetzung für eine Nachbearbeitung. Kameras mit VHS- oder
Super-VHS werden deshalb kaum noch angeboten. Und Mini-DV-Kameras finden sich in
den Sonderangeboten der Großmärkte schon für 500 Euro.
 Leider verfügen
viele dieser Kameras nicht über
eine Eigenschaft, die für die Nachbearbeitung unerlässlich ist. Denn von der
Möglichkeit, verlustfreie Kopien herzustellen, hab ich ja nur dann etwas, wenn
die Kamera über einen DV-Ausgang und einen DV-Eingang verfügt. Gerade
letzteres ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit, was an unserer Steuergesetzgebung liegt. Kameras mit einem Eingang werden nämlich wie
Videorecorder behandelt, was sie ja auch(!) sind, und unterliegen damit einem
höheren Einfuhrzoll. Und das schlägt sich auch im Preis nieder.
Leider verfügen
viele dieser Kameras nicht über
eine Eigenschaft, die für die Nachbearbeitung unerlässlich ist. Denn von der
Möglichkeit, verlustfreie Kopien herzustellen, hab ich ja nur dann etwas, wenn
die Kamera über einen DV-Ausgang und einen DV-Eingang verfügt. Gerade
letzteres ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit, was an unserer Steuergesetzgebung liegt. Kameras mit einem Eingang werden nämlich wie
Videorecorder behandelt, was sie ja auch(!) sind, und unterliegen damit einem
höheren Einfuhrzoll. Und das schlägt sich auch im Preis nieder.
Selbst, wenn man aber eine Kamera gefunden
hat, die einen DV-Eingang (Prospekt-Deutsch: "DV-IN") hat, heißt das
noch lange nicht, dass man beispielsweise damit VHS-Videos
überspielen kann, was
gelegentlich für die Filmbearbeitung oder zur Aufbesserung alter Videos ins
DV-Format notwendig ist. "DV-Eingang" heißt eben noch lange
nicht "Super-Video IN". Man wird diesen Mangel spätestens bedauern,
wenn man nunmehr seine alten VHS-Videos mit annehmbarer Qualität auf Mini-DV
überspielen und dann(!) verlustfrei weiterverarbeiten möchte.
Ein kleiner Trost: Wenn man eine preiswerte DV-Kamera
fürs Schiff anschafft, welche weder DV-Eingang noch Ausgang hat, kann man
später dieses Material immer noch besser verarbeiten als zum Beispiel das beste
Super-VHS-Material. Nur eben nicht mit der eigenen Kamera.
 Soviel zum Format. Für den Gebrauch auf Yachten,
sollte die kürzeste Brennweite weit in den Weitwinkelbereich reichen, denn wegen
der beengten Raumverhältnisse auf einer Yacht kann man praktisch nur mit kurzen
Brennweiten arbeiten. Leider sieht es damit meist nicht gut aus. Eine recht
brauchbare "Notlösung" ist dann ein Weitwinkelvorsatz. Völlig
verzichten kann man auf einer Yacht (und auch sonst) auf ein Digitalzoom
("120fach" und was sich sonst so die Werbestrategen aus den Fingern
saugen). Auch die langen Brennweiten sind auf einer Yacht nicht zu gebrauchen,
weil alle solche Aufnahmen aus der Hand ausnahmslos verwackelt werden. Auch,
wenn es noch so verführerisch ist, eine andere Yacht auf offener See mit dem
Tele "heranholen" zu wollen.
Soviel zum Format. Für den Gebrauch auf Yachten,
sollte die kürzeste Brennweite weit in den Weitwinkelbereich reichen, denn wegen
der beengten Raumverhältnisse auf einer Yacht kann man praktisch nur mit kurzen
Brennweiten arbeiten. Leider sieht es damit meist nicht gut aus. Eine recht
brauchbare "Notlösung" ist dann ein Weitwinkelvorsatz. Völlig
verzichten kann man auf einer Yacht (und auch sonst) auf ein Digitalzoom
("120fach" und was sich sonst so die Werbestrategen aus den Fingern
saugen). Auch die langen Brennweiten sind auf einer Yacht nicht zu gebrauchen,
weil alle solche Aufnahmen aus der Hand ausnahmslos verwackelt werden. Auch,
wenn es noch so verführerisch ist, eine andere Yacht auf offener See mit dem
Tele "heranholen" zu wollen.
 Damit sind die wichtigsten Dinge für die Auswahl
der Kamera schon gesagt. Dass mit steigendem Preis die Qualität im allgemeinen
ebenfalls steigt, ist im Großen und Ganzen logisch. Dass diese kleinen
Wunderdinger nicht Fernseh-Bild-Qualität erreichen können ist eigentlich
logisch. Wem es auf den einen oder anderen großen Schein nicht so sehr ankommt,
kann ja eine Drei-Chip-Kamera (Bild!) kaufen, die sichtbar bessere Bildqualität liefert
als die Winzlinge mit einem Chip.
Damit sind die wichtigsten Dinge für die Auswahl
der Kamera schon gesagt. Dass mit steigendem Preis die Qualität im allgemeinen
ebenfalls steigt, ist im Großen und Ganzen logisch. Dass diese kleinen
Wunderdinger nicht Fernseh-Bild-Qualität erreichen können ist eigentlich
logisch. Wem es auf den einen oder anderen großen Schein nicht so sehr ankommt,
kann ja eine Drei-Chip-Kamera (Bild!) kaufen, die sichtbar bessere Bildqualität liefert
als die Winzlinge mit einem Chip.
Auch, wenn das Wunder der Technik noch so reizt: Die Kamera
sollte nicht zu klein sein. Ist es ohnehin schon sehr schwierig,
verwackelungsfreie Videosequenzen zu bekommen, ist es bei den
handflächengroßen Kameras praktisch unmöglich.
Als Zubehör brauchen wir nicht viel:
Ersatzakku ist ein Muss, ebenso die Möglichkeit, den Akku an Bord laden zu
können, also ein "Auto-Netzgerät". Das wertvolle Objektiv schützen
wir am besten durch einen UV-Filter, der sich im Falle eines Kratzers erheblich
billiger ersetzen lässt als das Orginal-Objektiv.
Letzte Frage: "Normale",
"wassergeschützte" oder Unterwasser-Kameras?
 Klar wäre es an Bord besser, eine so robuste
Kamera zu haben, dass sie auch mal im Cockpit rum liegen oder auch mal einen
Spritzer Wasser abhaben kann, ohne gleich den Geist aufzugeben. Aber, das
Angebot bei den "wassergeschützten" (nicht wasserdicht!) ist so
ausgedünnt, dass obige, unbedingte Forderungen nicht erfüllt werden. Darüber
hinaus gibt es für jede Kamera recht preiswerte Gehäuse aus flexiblem Kunststoff (Ewa-Marine-Gehäuse), wenn
man unbedingt Aufnahmen bei "schwerem Wetter" oder beim Schnorcheln
machen möchte.
Klar wäre es an Bord besser, eine so robuste
Kamera zu haben, dass sie auch mal im Cockpit rum liegen oder auch mal einen
Spritzer Wasser abhaben kann, ohne gleich den Geist aufzugeben. Aber, das
Angebot bei den "wassergeschützten" (nicht wasserdicht!) ist so
ausgedünnt, dass obige, unbedingte Forderungen nicht erfüllt werden. Darüber
hinaus gibt es für jede Kamera recht preiswerte Gehäuse aus flexiblem Kunststoff (Ewa-Marine-Gehäuse), wenn
man unbedingt Aufnahmen bei "schwerem Wetter" oder beim Schnorcheln
machen möchte.
Zusammenfassung: Wenn die Kamera den
DV-Ein-und-Ausgang hat, ist man mit den üblichen Sonderangeboten bestens
bedient.
Diese
Kamera eignet sich am besten:
-
Mini-DV-Kamera
-
DV-Ein-und DV-Ausgang
-
Objektiv hat guten
Weitwinkelbereich
-
Zubehör: UV-Filter,
Ersatz-Akku, Bordnetzgerät
|
Die schlimmsten Fehler beim "Filmen".
Eine guten Film zu machen, ist sehr schwer, im
Urlaub kaum möglich und auf Langfahrt auch nur dann zu erreichen, wenn man sich
weitgehend aufs Filmen konzentriert. Benutzt man "nur so nebenbei" die
Video-Kamera, erreicht man ein sehenswertes Ergebnis nur dann, wenn man zumindest
versucht, die schlimmsten Fehler zu vermeiden und ein paar Punkte beachtet.
Grundsatz Nummer 1: Alles bewegt sich, nur die
Kamera nicht.
Die Konsequenz daraus heißt: Wenn immer es
möglich ist, muss ein Stativ, zumindest ein fester Standpunkt benutzt werden.
Gerade das aber ist auf der bewegten Yacht besonders
schwierig. Der Zubehörhandel
bietet Klemmen an, mit denen die Kamera irgendwo befestigt werden kann, zum
Beispiel am Niedergang oder an der Reling u.s.f. Für uns Amateure reicht für
die paar hundert Gramm wiegenden Kameras ein leichtes Stativ aus, auch wenn die
Profis dafür nur ein mildes Lächeln übrig haben.
 Ein guter Notbehelf für einen ruhigen
Kamera-Stand ist ein kleines Utensil, das die Profis unter den Kamera-Leuten
gelegentlich und genau mit "Erbsensack" bezeichnen, nichts anderes als
ein Ledersack mit Reis oder Erbsen gefüllt. Damit kann unsere leichte Kamera
schnell unkompliziert für eine Einstellung positioniert werden, ohne lang ein
Stativ aufstellen zu müssen (Bild).
Ein guter Notbehelf für einen ruhigen
Kamera-Stand ist ein kleines Utensil, das die Profis unter den Kamera-Leuten
gelegentlich und genau mit "Erbsensack" bezeichnen, nichts anderes als
ein Ledersack mit Reis oder Erbsen gefüllt. Damit kann unsere leichte Kamera
schnell unkompliziert für eine Einstellung positioniert werden, ohne lang ein
Stativ aufstellen zu müssen (Bild).
An Bord lässt sich freilich die Regel "nur
vom Stativ!" nicht lückenlos einhalten. Gelegentlich ist ein Objekt so
lohnend (Delphine!), dass es schade wäre, von vorneherein zu verzichten. Dann
aber ist es sinnvoll, die Kamera nach Möglichkeit irgendwo abzustützen oder
mit einem kleinen Schulterstativ oder einem
schnell einsetzbaren Einbeinstativ zu arbeiten.
Niemals hierbei eine
Teleeinstellung benutzen, das wird garantiert nichts! Lieber das Objektiv ganz
in die Weitwinkeleinstellung fahren, selbst wenn dann das Objekt das Bild nicht ausfüllt.
Auf einer Yacht wird sich immer die Frage
ergeben, ob man denn nun vom Stativ auf den Horizont und ihn damit praktisch
immer schief halten oder in diesem Fall ausnahmsweise aus der Hand filmen und
dabei versuchen soll, den Horizont gerade zu halten. Beides ist richtig. Je nach
Wetter und Seegang kann die eine oder andere Einstellung mehr Dramatik
vermitteln. Deshalb filme man vorsichtshalber mit beiden Einstellungen und entscheide
anschließend beim Schnitt, was mehr Spannung rüberbringt.
Grundsatz Nummer 2: Keine Schwenks!
Ruckfreie Schwenks kann man vom
Amateur-Stativ ohnehin nicht machen. Und das ist gut so. Denn der Hobbyfilmer neigt
förmlich dazu, die "Landschaft" abzuschwenken. Die Ergebnisse sind
langweilig bis verheerend. Ein richtiger Schwenk darf nämlich nur sehr träge
durchgezogen werden, was später im fertigen Film ermüdend wirkt. Das gibt kaum
eine Landschaft her, schon gar nicht die See.
Grundsatz Nummer 3: Keine Zoomfahrten!
Noch wichtiger ist es, auf Zooms völlig zu
verzichten. Die Taste fürs Motor-Zoom verführt gerade dazu, mit der Brennweite hin- und
herzufahren. Im Moment der Aufnahme findet der Kameramann diese Suchbewegung des
Objektivs vielleicht ganz interessant, im fertigen Film demaskiert sie gnadenlos
den Amateur als blutigen Anfänger. Deshalb die Zoomtaste nur und
ausschließlich dazu zu benutzen, um den richtigen Ausschnitt zu finden! Und
wenn man schon der Versuchung nicht widerstehen kann, das heute übliche
Motorzoom beim Filmen zu drücken, dann sollte die Einstellung nach dem Zoomen
so lange sein, dass man später beim Schneiden den Zoom wegschmeißen kann. Man
wird es immer tun.
Grundsatz Nummer 4: Kein Autofokus!
Der so sehr bequeme Autofokus (Werbung: "Um
die Scharfstellung kümmert sich die automatische Scharfeinstellung") darf nur
dazu benutzt werden, um ein Objekt vor(!) der Aufnahme scharf zu
stellen. Denn
beim eigentlichen Film wird bei einem bewegten Objekt, zum Beispiel Seegang, das
"Pumpen", also das Nachstellen der
Schärfe durch den Autofokus, die Aufnahme wertlos machen. Im übrigen ist
die Tiefenschärfe bei dem von uns benutzten Videoformat jedenfalls untertags
so groß, dass - außer bei Makroaufnahmen - eine grobe Einstellung - z.B. auf
circa 2 Meter - alles ausreichend zwischen einem Meter und Unendlich schärft.
Ausprobieren! Und Teleaufnahmen, bei denen das Objekt leicht aus der
Tiefenschärfe rausfällt, werden wir an Bord kaum machen (können).
Grundsatz Nummer 5: Lange
Einstellungen filmen!
Jede Einstellung lässt sich hernach beim Schnitt
kürzen, umgekehrt geht es - logisch - nicht. Will man den Film vorzeigbar
machen, muss ohnehin jede(!) Einstellung bearbeitet, also geschnitten werden. Außerdem: Das Film-Material kostet praktisch nichts.
Grundsatz Nummer 6: Einen großen Vorrat an
Zwischenschnitten filmen!
Jeder Film lebt vom Wechsel der
Einstellungen.
Allerdings kann später nicht einfach von Einstellung zu Einstellung geschnitten
werden, sondern der Schnitt muss ein paar logischen Regeln folgen. Stark
vereinfacht: Der Skipper kann nicht am Ruder und in der nächsten Einstellung
auf dem Vorschiff beim Segelwechsel gezeigt werden. Erträglicher wird es, wenn
zwischen den beiden Szenen ein Zwischenschnitt eingefügt wird, also zum
Beispiel die drehende Winschtrommel, der Kompass in Großaufnahme, der
Verklicker, die Gastlandflagge in der Saling etc.
Oft stellt man beim Schneiden einen Mangel an
Zwischenschnitten fest. Ein Fehler, der sich zu Hause nicht mehr ausbügeln
lässt und an Bord so leicht zu vermeiden gewesen wäre. Möchte man einen
interessanten Halbstunden-Film vom letzten Törn schneiden, ist ein Vorrat von
20 Zwischenschnitten schnell aufgebraucht.
Die Nachbearbeitung
 Ein unbearbeiteter Film ist für alle anderen
Zuschauer eine Zumutung. Immer! Deshalb muss jedes Videomaterial geschnitten und
vertont werden. Arbeitet man mit dem Mini-DV-Format, so hat jeder zumindest die
technischen Möglichkeiten, fast professionelle Ergebnisse zu erzielen.
Voraussetzung ist ein Computer der neueren Generation mit der sogenannten
Firewire-Schnittstelle (auch als "IEEE 1394"
bezeichnet) oder zumindest ein Computer, der mittels Firewire-Karte um diese Schnittstelle nachgerüstet werden kann. Bei einem Notebook wäre somit
ein PCMCIA-Einschub notwendig, wo dann eine entsprechende Karte (um die 100
Euro) eingeschoben werden kann. Nur mittels dieser Schnittstelle ist
Ein unbearbeiteter Film ist für alle anderen
Zuschauer eine Zumutung. Immer! Deshalb muss jedes Videomaterial geschnitten und
vertont werden. Arbeitet man mit dem Mini-DV-Format, so hat jeder zumindest die
technischen Möglichkeiten, fast professionelle Ergebnisse zu erzielen.
Voraussetzung ist ein Computer der neueren Generation mit der sogenannten
Firewire-Schnittstelle (auch als "IEEE 1394"
bezeichnet) oder zumindest ein Computer, der mittels Firewire-Karte um diese Schnittstelle nachgerüstet werden kann. Bei einem Notebook wäre somit
ein PCMCIA-Einschub notwendig, wo dann eine entsprechende Karte (um die 100
Euro) eingeschoben werden kann. Nur mittels dieser Schnittstelle ist  nämlich
die Übertragung von Videomaterial in den Computer ohne jeden Qualitätsverlust
möglich. Wer sich noch an die stümperhaften Versuche erinnern kann,
VHS-Material zu schneiden, wird den gewaltigen Fortschritt, die uns Firewire
gebracht hat, ermessen können. Damals war nämlich ein zweimal umkopiertes
Video in der Qualität bereits so schlecht, dass man es kaum noch jemand zumuten
konnte. Mittels Firewire kann das Videomaterial beliebig oft umkopiert
werden,
ohne dass ein Qualitätsverlust eintritt.
nämlich
die Übertragung von Videomaterial in den Computer ohne jeden Qualitätsverlust
möglich. Wer sich noch an die stümperhaften Versuche erinnern kann,
VHS-Material zu schneiden, wird den gewaltigen Fortschritt, die uns Firewire
gebracht hat, ermessen können. Damals war nämlich ein zweimal umkopiertes
Video in der Qualität bereits so schlecht, dass man es kaum noch jemand zumuten
konnte. Mittels Firewire kann das Videomaterial beliebig oft umkopiert
werden,
ohne dass ein Qualitätsverlust eintritt.
Die Bearbeitung eines Films spielt sich also in
folgenden Schritten ab:
- Material von der Kamera auf den Computer
aufspielen
- Material im Computer schneiden und vertonen
- Fertigen Film wieder auf die Kamera oder einen
anderen Recorder (DV-Format!) zurückspielen und vorführen.
An Bord wird man wohl kaum einen Mini-DV-Recorder zur
Verfügung haben, wohl aber einen Notebook und die Kamera.
Heute kann der fertige Film auch schon in
beachtlicher Qualität auf eine CD - nicht DVD - gebrannt
werden - mit einer
Spieldauer von rund einer Stunde. Können wir uns also den DV-Recorder,
beziehungsweise die Kamera mit DV-Eingang sparen? Nein!
Die Ursache hierfür ist die Tatsache, dass das
DV-Material auf dem Computer derart viel Speicherplatz benötigt, dass zumindest
auf dem Notebook die Festplatte platzmäßig überfordert wäre. Fünf Minuten
Videomaterial im Digitalformat benötigen nämlich schon rund ein Gigabyte. Dies
führt dazu, dass auf Langfahrtyachten immer mehr externe Festplatten
(160 GB kosten
nur noch wenig über 100 Euro) eingesetzt werden, auch als  Daten-Backup-System.
Ihr Anschluss ist mit USB2.0 (Bild) kein Problem mehr.
Daten-Backup-System.
Ihr Anschluss ist mit USB2.0 (Bild) kein Problem mehr.
Trotzdem wird man einen Film
nicht "in einem Rutsch" am Computer schneiden können, denn man wird
ihn in Fünf- oder Zehn-Minutenabschnitte zerlegen,
fertig stellen und erst
ganz zum Schluss zu einem Werk zusammenfügen. Hier zeigt sich dann der große
Vorteil der verlustfreien Überspielmöglichkeit. Man kann die Filmsequenzen so
oft man will überarbeiten und zwischenzeitlich durch Überspielen auf den
Recorder (Kamera) auf Band sichern.
Eine Voraussetzung muss der Notebook noch
bringen. Sein Pentium sollte schon über ein Gigahertz schnell sein, damit die
großen Datenmengen verlustfrei überspielt werden können, somit die
gefürchteten "dropped frames" vermieden werden.
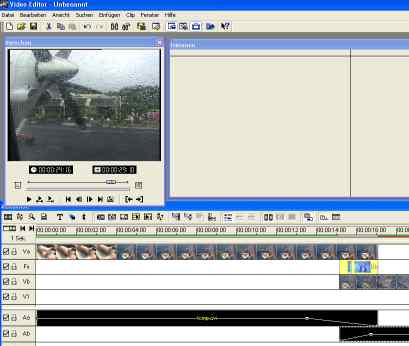 Eines
können wir uns kaum ersparen: Ein
gutes Schneideprogramm müssen wir uns anschaffen. Zwar liefert das
Betriebssystem Windows XP den Windows Movie Maker kostenlos mit, aber dessen
Möglichkeiten sind doch arg beschränkt. Ernsthafte Filmamateure benutzen die
Software "Adobe
Premiere Pro", wie die letzte Ausgabe heißt, während der Autor beste
Erfahrungen gemacht hat mit Media Studio Pro 7 von Ulead.
Eines
können wir uns kaum ersparen: Ein
gutes Schneideprogramm müssen wir uns anschaffen. Zwar liefert das
Betriebssystem Windows XP den Windows Movie Maker kostenlos mit, aber dessen
Möglichkeiten sind doch arg beschränkt. Ernsthafte Filmamateure benutzen die
Software "Adobe
Premiere Pro", wie die letzte Ausgabe heißt, während der Autor beste
Erfahrungen gemacht hat mit Media Studio Pro 7 von Ulead.
Das Schneiden des Films ist Gewöhnungssache.
Wenn aber mal die Technik, Schnitte zu setzen, ins Fleisch und Blut
übergegangen ist, wird es mit den genannten Programmen zum vergnüglichen
(tagelangem) Zeitvertreib.
Media Pro bringt übrigens alle Werkzeuge mit, um die
Kamera
derart anzusteuern, damit die Filmdateien von der Kamera auf den Computer und
nach der Bearbeitung zurück aufs Band gespielt werden können. Es scheint, dass zwischen Sony-Kameras am wenigsten Kommunikationsprobleme
zwischen Computer und Recorder auftreten. Ein kleines Manko bei Ulead hab ich zu
kritisieren. Bei der Überspielung auf den Notebook mittel Video Capture werden
die "dropped frames", also die "fallengelassenen Bilder"
(sollten immer Null sein) angegeben, während beim Zurückspielen mittels des
Befehls "Exportieren" diese Angabe fehlt.
Ein guter Videoschnitt über die reine
handwerkliche Technik hinaus ist eine Kunst. Nicht umsonst sind berufsmäßige
gute Cutter genauso gefragt in der Filmbranche wie Kameraleute oder andere
Spezialisten aus der Filmbranche. Es wäre deshalb
vermessen, zu glauben, dass wir als Amateure professionelle Ergebnisse zustande
bringen. Aber
vorzeigbar sollten sie sein.
Drei wichtige Tipps sollten Anfängern beim Film
schneiden
helfen:
Herzhaft schneiden!
Es ist klar, dass der "Filmemacher" an
jeder Einstellung hängt und ständig glaubt, gerade diese würde eine wichtige
Information enthalten. Andererseits wird jeder Amateur-Film erfahrungsgemäß zu
lang. 60 Minuten Gesamtlaufzeit ist das Äußerste, was man seinen Zuschauern
zumuten kann, besser sind 30 Minuten. Hat man einigermaßen Material wird man
diese Zeiten leicht füllen können. Man halte sich vor Augen: Oftmals reicht es
aus, ein Fünftel oder gar nur ein Zehntel des Rohmaterials zu verwenden.
Mit Übergangs- und sonstigen Effekten
geizen!
Gerade moderne Schneideprogramme bieten Dutzende
von Übergangseffekten, die für sich allein gesehen einen professionellen
Eindruck machen. Wenn aber reines Amateurmaterial mit solchen
"Maschineneffekten" oder Bildverfremdungen aufgefüllt wird, dann
wirkt das nach den ersten zwei oder drei Überraschungen sehr bald lächerlich.
Denn auch der unbedarfteste Zuschauer merkt heute sehr schnell, dass diese
Spielereien Computerwerk sind. Gutes Ausgangsmaterial braucht diese Effekte
nicht. Gelegentliche einfache Über-, Aus oder Ein-Blendungen reichen völlig.
Künstliche Effekte können Zwischenschnitte - siehe oben - nicht ersetzen.
Vertonung erst ganz zum Schluss!
Ein Film ohne Musik ist fad. Mit den
modernen
Schneideprogrammen ist die Vertonung (Kommentar, Originalgeräusche, Musik oder
alles gleichzeitig) kein technisches Kunststück mehr. Keinesfalls sollte
Kommentar oder Musik den Originalton des Films ersetzen. Denn der O-Ton ist für
die Atmosphäre unverzichtbar.
Bei der Erstellung eines Films darf die Vertonung
erst der allerletzte Schritt sein. Denn nachträgliche Änderungen (Schnitte)
sind dann nicht mehr möglich. Unser Ohr ist viel empfindlicher als unsere
Augen. Ist einer Szene einmal Musik unterlegt, dann kann sie nicht mehr
geschnitten werden, denn der Zuhörer nimmt den Schnitt als Bruch in der Musik
unüberhörbar und störend wahr. Amateurhaft würde das wirken und gerade das
wollen wir ja vermeiden!